| Ingeborg
Bachmann Forum |
| Zeichenerklärung: |
| Leseprobe... | |||
| Aldo Giorgio Gargani | Um die einzige echte Sprache in der Spannung des Wortes gegenüber dem Bereich des "Unsagbaren", des Schattens und der Finsternis auszumachen, greift Ingeborg Bachmann eines der Zentralthemen auf, das sie in ihren Aufsätzen über Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus erarbeitet, später aber auf eigenständige und von Wittgenstein unabhängige Weise entwickelt hatte. Es geht um eine Sprache, die in der Spannung gegen das benutzt wird, was sich in der Sprache zeigt, aber was nicht gesagt und ausgedrückt werden kann. Diese Sprache bildet die dunkle Kehrseite der Existenz, wo das Wort wieder Bedeutung und gleichzeitig eine ethische Dimension und den Wert einer Hoffnung erlangt. Jener unlösliche Zusammenhang zwischen kritischer Sprachanalyse und ethischem Einsatz für eine neue Welt bildet die wesentliche Struktur, die die Grundlage von Bachmanns Poesie und Prosa ausmacht. So schreibt sie in der ersten der fünf Frankfurter Vorlesungen, Fragen und Scheinfragen: »Mit einer neuen Sprache wird der Wirklichkeit immer dort begegnet, wo ein moralischer, erkenntnishafter Ruck geschieht, und nicht, wo man versucht, die Sprache an sich neu zu machen, als könnte Sprache selber die Erkenntnis eintreiben und die Erfahrung kundtun, die man nie gehabt hat.« [1]Es handelt sich nicht nur um eine intellektuelle, literarische und philosophische Erfahrung im engeren Sinn, sondern auch um einen neuen geistigen, ethischen Sinn, sondern auch um einen neuen geistigen, ethischen und existenziellen Einsatz. »Eine neue Sprache muß eine neue Gangart haben, und diese Gangart hat sie nur, wenn ein neuer Geist sie bewohnt.« [2] Die Sprache ist für den Schriftsteller kein zum Besitz und zum "Gebrauch" bestimmter gesellschaftlicher und institutioneller "Materialvorrat", denn sie entspricht vielmehr, laut Bachmann, »einem notwendigen Antrieb, den ich vorläufig nicht anders als einen moralischen vor aller Moral zu identifizieren weiß... einer Stoßkraft für ein Denken, das zuerst noch nicht um Richtung besorgt ist, einem Denken, das Erkenntnis will und mit der Sprache und durch die Sprache hindurch etwas erreichen will.« [3]Dieses mit der Sprache zu erreichende "Etwas", dieser dunkle und unvorhersehbare Bereich ist das, was Bachmann als "Realität" definiert. Bachmann greift Wittgensteins Behauptung über die Grenzen der Sprache auf und führt sie gleichzeitig auf eine von dem österreichischen Philosophen unabhängige Art und Weise weiter. Wie Bachmann in Sagbares und Unsagbares. Die Philosophie Ludwig Wittgensteins erklärt, ist die Metaphysik der irrige Versuch, das "Lebensgefühl" in der Sprache auszudrücken, die zur Bezeichnung der Tatsachen bestimmt ist. Das ist unmöglich und sinnlos, aber Bachmann unterstreicht auch, daß das Lebensgefühl, das mitzuteilen der Sprache der Metaphysik verboten ist, seinen Ausdruck durch die künstlerische Form der Dichtung und der Literatur finden kann. Das Lebensgefühl aber kann auf dem Weg künstlerischer Gestaltung seinen Ausdruck finden ... Ein Kunstwerk argumentiert nicht. Die Metaphysik jedoch argumentiert und besteht darauf, Erkenntnisse zu vermitteln". [4]Bachmann erklärt daher, daß der Schriftsteller eine neue Sprache und eine neue Welt entdecken und dabei vom Inneren der Grenzen her, die von der gewöhnlichen Sprache und der institutionellen Welt gesetzt sind, wirken muß: "Er muß im Rahmen der ihm gezogenen Grenzen ihre Zeichen fixieren und sie [die Sprache] ... wieder lebendig machen." Im Fall Bachmanns handelt es sich um eine sprachliche Hoffnung und um einen ethischen Einsatz; in diesen schwankt die Sprache zwischen der positivistischen Feststellung der Tatsachen, der "Welt, wie ich sie vorfand", um den Ausdruck des Tractatus logico-philosophicus zu gebrauchen, und der Welt, die jene Zeit ist, die es noch nicht gibt. An einer entscheidenden Stelle der Frankfurter Vorlesungen sagt Bachmann, dem Dichter gelänge im glücklichsten Fall zweierlei hinsichtlich der bestimmten geschichtlichen Welt, in der er sich befindet, und hinsichtlich der Welt, die noch nicht ist und nur eine lebendige Gewißheit darstellt: "Gelingen kann ihm, im glücklichsten Fall zweierlei: zu repräsentieren, seine Zeit zu repräsentieren, und etwas zu präsentieren, für das die Zeit noch nicht gekommen ist." Man muß diese beiden Möglichkeiten betrachten, aus deren Verhältnis zueinander die spezifische Spannung von Bachmanns dichterischem Sagen und ihrem literarischen Erzählen hervorgeht. Einerseits betrachet Bachmann den Augenblick, in dem es darum geht, die Welt zu repräsentieren, die es bis zur Gegenwart gegeben hat, bis zu genau dem Moment, in dem das Dichterische zum Vorschein kommt; dann, in einem späteren Augenblick, geht es nicht mehr darum, zu repräsentieren, sondern zu präsentieren. Das Repräsentieren ist ein Wiederholen, ein Beschreiben, ein Feststellen, ein Widerspiegeln der "Welt, wie ich sie vorfand", oder, wie es über Malina gesagt wird: "Für ihn ist offenbar die Welt, wie sie eben ist, wie er sie vorgefunden hat." [5] Präsentieren hingegen bedeutet, von einer Welt zu sprechen, die es noch nicht gibt, die nicht in die Dimension der Zeit eingeschrieben ist. Im ersten Augenblick spiegelt die Sprache das wider, was es gibt, das heißt, sie repräsentiert, während im zweiten Augenblick die Sprache "auf eigene Faust" handelt, um es mit Wittgenstein zu sagen; sie präsentiert, sie leitet ein. Das Repräsentieren drückt den geschichtlichen und existentiellen Prozeß in seinem zeitlichen Verlauf aus, während das Präsentieren auf eine Utopie hinweist, einen Nicht-Ort und eine Nicht-Zeit. Bachmann bezeichnet das als das Aufreißen einer Vertikale außerhalb des Raumes und der Zeit. "Es gibt in der Kunst", schreibt sie, "keinen Fortschritt in der Horizontale, sondern nur das immer neue Aufreißen einer Vertikale". Hier greift Bachmann das Thema eines Autors wieder auf, von dem sie zugibt, er habe sie beeinflußt, nämlich Otto Weininger. In "Über die letzten Dinge" erkennt dieser die Freiheit und das Selbstverständnis, das der Mensch haben kann, ausschlie▀lich im gegenwärtigen Moment, in dem Moment, in dem der Mensch "ein zeitloster Akt, den er immer wieder vollzieht", wird; mit anderen Worten, jene zeitlose Gegenwart, die dem "Heute" entspricht, das der entscheidende und schicksalhafte Moment ist, in dem die Sprache zu einer ohnmächtigen, verzweifelten wird, als wäre sie eine Fälschung. Dieses "Heute" bildet auch das Eröffnungs- und Schlußthema von Malina. »Denn es ist mir fast unmöglich, "heute" zu sagen... so hoffnungslos ist meine Beziehung zu "heute", denn durch dieses Heute kann ich nur noch in höchster Angst und fliegender Eile kommen und davon schreiben... denn vernichten müßte man es sofort, was über Heute geschrieben wird...Nur ich fürchte, es ist "heute", das für mich zu erregend ist, zu maßlos, zu ergreifend, und in dieser pathologischen Erregung wird bis zum letzten Augenbilck für mich "heute" sein.«Am Ende des Romans schreibt Bachmann: "Heute darf nicht vorbei sein. Es darf nicht wahr sein." [6] | ||
Der unendliche Satz. Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann |
|||
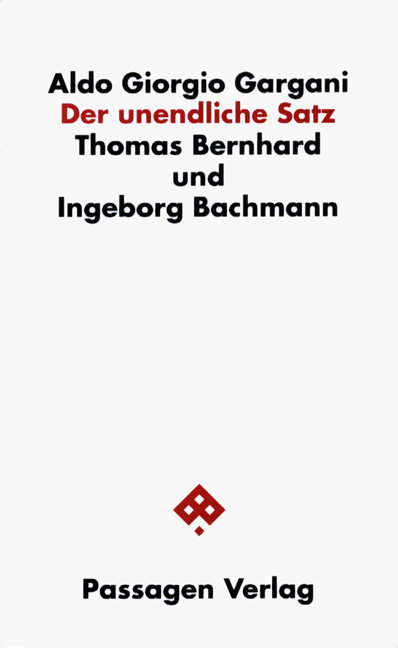 Wien 1997 152 Seiten ISBN 978-3-85165-265-9 |
|||
| Buchbesprechungen: |
| Information zu dieser Seite: | Zeichenerklärung: |
|
| [1] | Zitiert aus: Ingeborg Bachmann. Werke, hg. von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum und Clemens Münster, München-Zürich: Piper Verlag 1982 [1. Aufl. 1978] Bd. IV: Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtungen, S. 192. | |
| [2] | Ebenda. | |
| [3] | Vgl. ebenda, S. 192 - 193. | |
| [4] | Ingeborg Bachmann. Werke Bd. IV, Sagbares und Unsagbares. Die Philosophie Ludwig Wittgensteins, S. 111 - 112. | |
| [5] | Ingeborg Bachmann. Werke Bd. III, S. 250. | |
| [6] | Ebenda, S. 317. | |
| Mein Dank geht an dieser Stelle an den © Passagen Verlag, Wien für die freundliche Unterstützung und Genehmigung zur Publikation; die Leseprobe entstammt dem Kapitel II. Das erzählte Denken. Über Ingeborg Bachmannm, S. 83 - 86. | ||
| © Ricarda Berg, erstellt:
August 2025, letzte Änderung:
01.10.2025 http://www.ingeborg-bachmann-forum.de - E-Mail: Ricarda Berg |
||
| Ingeborg Bachmann Forum | Leseproben (Index) | Kleine Bibliothek | Bibliographie | Top | ||