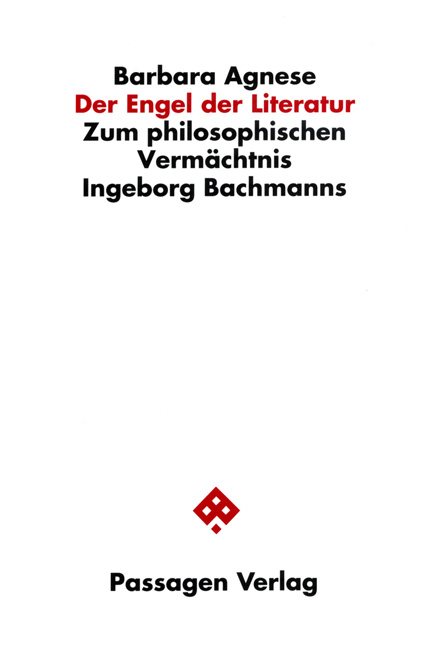|
Barbara Agnese |
|
[...] Die öffentlichen Gewaltbilder, die historisch-politischen Verkörperungen der Gewalt gewinnen in der Bachmannschen Prosa eine neue, ausschließlich auf das Individuum zentrierte Dimension. Als ob die Gewalt von einer öffentlichen immer mehr auf eine private Bühne überginge, um schließlich und unauslöschlich im Innenleben der einzelnen zu erstarren. In diesem Sinn stellen die Todesarten das Bild eines sakrifiziellen Zusammenlebens dar, wie der Essay Jean Amérys "über die Tortur" die modernde sakrifizielle Gesellschaft par excellence, die während der geschichtlichen Erfahrung des Nationalsozialismus realisiert wurde, demaskiert. Im Franza-Roman ist die Entwicklung des geschichtlichen Phänomens auf privater Ebene zu finden, indem Bachmanns massive Anklage gegen ein in neuen Formen wiederentstandenes sakrifizielles Denken offenbar wird. Die geschichtliche Erfahrung des Nationalsozialismus und des Faschismus wird bei Bachmann zum bevorzugten Bild, um die geheime Gewalt der sakrifiziellen Beziehungen zwischen den Menschen in der Gegenwart zu schildern - genauso wie es der Fall für das Verhältnis des Krieges zum Frieden war. Das Bild des Krieges ist nichts anderes als ein besonderer Fall des Normalfalls, kein qualititativ außerordentlicher Zustand, sondern die Ausnahme, die die Regel des alltäglichen Konflikts bestätigt. Das Gegenteil denken, würde verfehlen. Der Todesarten-Plan versucht, die öffentlichen und allgemeinen Dimensionen des Friedens zurückzuführen. Es gibt also keinen Sprung von der Wirklichkeit der Phantasie, zur Fiktion, sondern von einer Wirklichkeitsebene in eine andere, oder besser gesagt von einer Gewaltwirklichkeit in eine andere Dimension der Gewalt unter verschiedenen Verhältnissen. Die eigentliche dichterische Entwicklung, die Bachmann ausgehend von der Schmerzerfahrung Amérys macht, wäre nicht so sehr auf die Erzählung "Drei Wege zum See" zu beziehen, sondern eher auf Franzas Zerstörungsprozeß.
Die Analogie zwischen beiden Darstellungen des Bösen im Buch Franza und im Essay scheint gerechtfertigt, insofern dadurch eine Psychopathologie des gefährlichsten und radikalsten unter den verbrecherischen Verhalten herausgearbeitet wird. Ihrem Bruder beschreibt Franza Jordans "Verfahrensweise":
»Du sagst Faschismus, [...] ich habe das noch nie gehört als Wort für ein privates Verhalten [...] warum redet man davon nur, wenn es um Ansichten und öffentliche Handlungen geht. Ja, er ist böse, auch wenn man heute nicht böse sagen darf, nur krank, aber was ist das für eine Krankheit, unter der die anderen leiden und der Kranke nicht. [...] Wenn es das gibt, und ich habe es bisher nicht bemerkt, wenn die Sadisten nicht nur auf psychiatrischen Abteilungen und in den Gerichtssälen zu finden sind, sondern unter uns sind, mit blütenweißen Hemden und Professorentitel, mit den Folterwerkzeugen der Intelligenz, [...]« [1]
[...] Damit scheint Bachmanns Ansicht einige Züge der Charakterologie des Verbrechers bei Weininger [2] zu übernehmen. Der Verbrecher begeht seine Untaten wegen eines ständigen Triebes zur Rache an den anderen. Weininger schreibt in der "Aufklärung über das Wesen des Verbrechers", die im Band über die letzten Dinge enthalten ist.
»Das Aufgeben seines freien Selbst äußert sich bei ihm [dem Verbrecher*] als Haß gegen alles, was noch frei ist. [...] Das Streben des Verbrechers ist, nichts frei zu lassen; weder sich, noch etwas anderes, [...] Die höheren Formen [des Dranges nach Verknüpfung (Unfreiheit)] gehen auf Vernichtung und Zerstörung; weil alle Existenz noch irgendwie frei ist.« [3]
[...] Die Gewalttätigkeit Jordans liegt in einem reduktionistischen Rationalitäts- verfahren, in dem der andere zum erschaffenden Gegenstand einer Theorie wird. Wie der Verbrecher Dinge nicht deswegen zwingt, weil er sie erkennen will, so zwingt Jordan die Sprache nicht deswegen, weil er die Natur Franzas erkennen will. Der Verbrecher - bemerkt Weininger - »will die Dinge zwingen, und darum auch erkennen.« [4]
So benutzt Jordan auch pseudo-wissenschaftliche Mittel, um Franza geistig zu enteignen, um die Natur des Opfers zum Schweigen zu bringen. In dieser Hinsicht könnte die Mystifikation der Sprache als Hauptbeispiel des raffinierten Verbrechens bezeichnet werden. In den geistigen Verbrechen tritt eigentlich das Prinzip des radikalen Bösen hervor. Eben deshalb sollte man die sublimen Verbrechen, die im Mittelpunkt der Todesarten stehen, nicht als metaphorische Entwicklungen der wirklichen Verbrechen im herkömmlichen Sinne betrachten. Jordan "ist das Exemplar, das heut regiert, [...] das Raubtier dieser Jahre, das Rudel Wölfe dieser Jahre" [5]. Die Lehre des "Falls" Franza lautet: Wenn einem Menschen sein eigenes symbolisches Wesen genommen wird, erfährt er das Vernichtetsein. So äußert sich Elisabeth Mantrei - die Protogonistin von "Drei Wege zum See" - darüber:
»Und ist es denn überhaupt noch nie jemand in den Sinn gekommen, daß man die Menschen umbringt, wenn man ihnen das Sprechen abnimmt und damit das Erleben und Denken.«
In dieser Erzählung wird dem Leser die für die ganze Todesarten-Probematik entscheidende Begegnung berichtet. Elisabeth Matrei erwähnt jenen Essay mit dem Titel "Über die Tortur", der von einem Österreicher, der in Belgien unter einem französischen Namen lebte, geschrieben worden war. Durch die Worte Amérys versteht Elisabeth Mantrei endlich, was Franz Joseph Trottas radikalste Kritik an den tatsächlichen Folgen ihrer guten Absichten, ihres Engagements als weltberühmte Photoreporterin auf der Ebene der Menschenwürde bedeutete:
»denn darin war ausdrückt, was sie und alle Journalisten nicht ausdrücken konnten, was auch die überlebenden Opfer, deren Aussagen man in rasch aufgezeichneten Dokumenten publizierte, nicht zu sagen vermochten. [...] Und um diese Seiten zu verstehen, [...] bedürfte es einer anderen Kapazität als der eines kleinen vorübergehenden Schreckens, weil dieser Mann versuchte, was mit ihm geschehen war, in der Zerstörung des Geistes aufzufinden und auf welche Weise sich wirklich ein Mensch verändert hatte und vernichtet weiterlebte.« [6]
Wie kann man »vernichtet weiterleben«? Das ist die Hauptfrage, die Bachmanns Schreiben der Verbrechen-mitten-im-Frieden beherrscht. Was geschieht mit einem während des Friedens im Geist zerstörten Menschen, der dann entdeckt, nichts anderes als "ein Spätschaden" zu sein? Das Wesen der Tortur, schreibt der Autor jenes Essays, ist sogar mehr als "die Grenzverletzung seines Ich durch den anderen, die weder durch Hilfserwartung neutralisiert, noch durch Gegenwehr begnadigt werden kann". Die Erfahrung der Tortur ist die Begegnung mit deinem unsagbaren Schmerz, der durch den Körper einen Charakter indelebilis in den Geist des Opfers einprägt. Die Tortur "läßt uns den eigenen Tod erleben". Diese den untergehenden Todesarten-Figuren tief verwandte Erfahrung kommt einem Verbrechen gleich, in dem das Opfer nach seiner eigenen Ermordung nicht weiterleben kann.
Es ist dieser der einzige, endgültige Zustand des Gemarterten.
[...] Der Mord ist Lüge: Das ist eigentlich die von Malina und allen Todesarten herkommende Lehre. Der kürzeste Weg, um das wahre Verbrechen - das verkannte, das verschwiegene, das vergessene und verdrängte - enthüllen zu können, ist, die Lüge, die es umgibt, zu demaskieren. [7] |